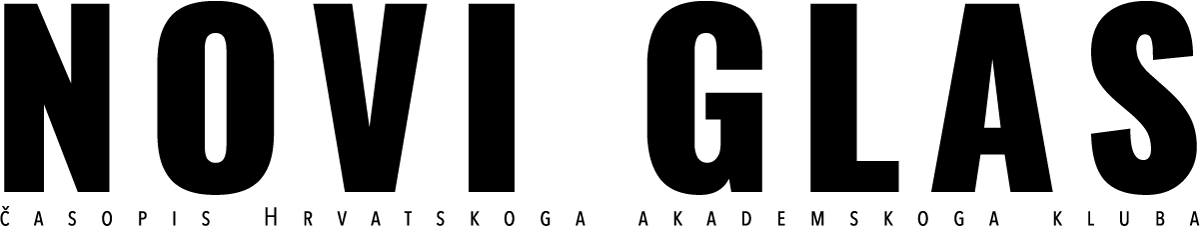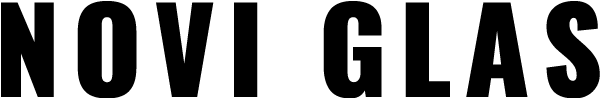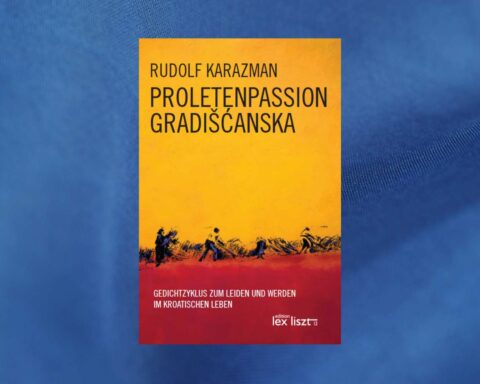Auf meinen Reisen in Ostafrika werde ich als Touristin ständig gefragt: „where do you come from?“ Ich als Weiße kann mir ausdenken, welches (europäische) Land ich als Antwort wähle – ein paar Floskeln und Phrasen kenne ich auf Französisch, Italienisch und Spanisch, Schwytzerdütsch und Hochdeutsch kann ich auch, sogar als Russin würde ich durchgehen.
Meine Wahl hat damit zu tun, wie ich eingeordnet werden möchte: Die Französinnen geben das meiste Trinkgeld, die Deutschen sind ein bisschen rau, zeigen jedoch ein weiches Herz, sobald es mal geknackt ist, die Italiener sind gesellig und meist in Gruppen unterwegs etc. – das alles sind Erkenntnisse aus der Feldforschung von beachboys in Sansibar, die ich nach Merkmalen befragte. Sie, die allein durch die Outfits der mzungusmzungus – aus dem Suaheli. Früher für weiße Forschungsreisende und Kolonialbeamte, heute allgemein für Weiße ziemlich treffsicher, ich würde sagen, zu 80 Prozent verschiedene Nationalitäten richtig zuordnen konnten, haben ihre Erfahrungen gemacht. Ich werde mich also davor hüten, mich als Schweizerin oder Russin auszugeben, diese werden nämlich als „the veryvery richest“ eingestuft, wobei erstere als die Knausrigeren und Bedachtsameren gelten, bei den anderen würden die Dollars lockerer sitzen und oft bündelweise aus der Tasche gezogen, ohne genau zu prüfen, wie viele Scheine es wären. Abgesehen vom Herkunftsort ist auch die Angabe der Unterkunft vorort für die Jungs ein Indiz, also aufgepasst: besser die basic Bungalowsiedlung eines Rasta als das Fünfsterne-Hotel nennen, um einen fairen Preis für den Perlenschmuck angeboten zu bekommen.
Ich bin gerne ein unbeschriebenes Blatt, ohne Geschichte. Oder mit einer ausgedachten. Ich kann alles sein als Fremde, mehr als nur ich.
Schon als Kind gefiel es mir, in die Haut und die Sprache einer Fremden zu schlüpfen. Wenn wir in den Sommerferien zu meiner Großmutter ins Südburgenland fuhren und ins Freibad durften, wo uns keiner kannte, gab ich mich bereits mit zehn Jahren erstaunlich unerschrocken als Französin aus. Brabbelte Kauderwelsch, erfand Wörter gespickt mit vielen Umlauten und versuchte mit der Unterlegung einer Melodie den für mich typischen Singsang der Franzosen nachzuahmen. Meiner kleinen Schwester hatte ich ein paar Verse eingetrichtert, frère Jacques,frère Jacques, die musste sie an meiner Seite zum Besten geben, dormez vous, dormez vous, wir taten dann so, als würden wir uns in der anderen Sprache verständigen und einander antworten – ein Riesenspaß für mich, ding dang dong. Ich war etwas Besonderes, fühlte mich den anderen Kindern durch das Sprechen einer anderen Sprache überlegen. Als Erwachsene wurde mir klar, dass ich in diesen Spielen eine Bekannte meiner Eltern aus Südfrankreich, deren Erscheinung und Auftreten mir gefielen, und das prägende Vorbild meiner Großmutter im Kopf hatte: diese war wie Tausende Burgenländer*innen Mitte der 1930er-Jahre mit dem Schiff nach New York gefahren, wo sie einige Jahre im Haushalt einer jüdischen Familie arbeitete. Die Fotos in den Amerika-Alben hatten mich tief beeindruckt und ihre „Geheimsprache“, eine Mischung aus Österreichisch, Englisch und Jiddisch, ebenso.
Aber warum habe ich mich als Französin ausgeben und nicht als Ungarin, Serbin, Tschechin oder Kroatin?
Dem damaligen Zeitgeist folgend waren wir vornehmlich Richtung Westen orientiert, wo Coca Cola und Marlboromen uns den Mund wässrig machten und einen Weg in eine verführerische Welt der Freiheit wiesen. Serbokroatisch konnte ich nicht. Sollte ich nicht können wollen. Weil die Schwierigkeiten, mit denen mein Vater aufgrund seiner Herkunft im deutschsprachigen Dorf konfrontiert war, so weit gingen, dass er mir und meiner Schwester seine Muttersprache nicht beibrachte – er wollte uns schützen. Mitschüler aus kroatischen Gemeinden wurden im Gymnasium der Bezirkshauptstadt von Deutschprofessoren wegen ihres Akzents vor der ganzen Klasse verhöhnt: „Die Gotz sitzt auf der Göllastiagen, gö, Gustric?“ und auch jenseits des Schulbetriebes ging man nicht zimperlich um mit Diskriminierung. Die Vorfahren der Burgenland-Kroaten waren bereits im 16. Jahrhundert aus verschiedenen Teilen Kroatiens ins damalige Westungarn ausgewandert, Türkenkriege und Pest hatten Dörfer und Landstriche leergefegt und wurden durch die neuen Siedler wieder gefüllt – und obwohl die Volksgruppe schon so lange hier beheimatet war, hatte sie noch in den 1970er-Jahren mit Vorurteilen zu kämpfen, wie absurd.
Ich war ein „Halbblut“, das nicht einmal die Sprache beherrschte, doch der Familienname verriet mich, weshalb ich mir angewöhnte, ihn möglichst wegzulassen oder Unverständliches zu murmeln, wenn ich danach gefragt wurde. Ich war ein Feigling, der sich nicht traute Farbe zu bekennen aus Angst vor Spott – „Grün und rot scheißt der Krowot!“ Der kroatischen Verwandtschaft wurde ihre Farbenfrohheit und ihre Sing- und Feierlaune vorgeworfen. Zu bunt und zu laut. Völker und Volksgruppen, die zu viel feiern, müssen einem suspekt sein. Die missachten den Ernst des Lebens.
Auch Afrikaner*innen sind bunt gekleidet und singen und tanzen gerne. Die Frage, die ihnen oft in Interviews gestellt wird: „Hat man dir schon ins Haar gegriffen?“, um sich dann gemeinsam zu einem Protest zusammenzutun und diese spezielle Art der Diskriminierung anzuprangern, ringt mir ein müdes Lächeln ab. Dont you worry sista of anotha motha, take a deep breath! Selbstverständlich greifen sie dir ins Haar, weil es anders ist als das eigene: fein und glatt und sonnengelb. Es ist reinste Neugier, die dahintersteckt, sowohl Kleinkinder wie alte Frauen haben mit meinem Haar gespielt, es fasziniert befühlt und zwischen ihren Fingern durchgleiten lassen. Ich habe es geschehen lassen und es hat mir gefallen – hakuna matata.
Zusätzlich zu meinen Freibadabenteuern als Französin bastelte ich mir als junges Mädchen Ausweise im Führerschein-Format. Ich schnitt Fotos von Frauen, die mir gefielen, aus den Modezeitschriften meiner Mutter aus und klebte sie hinein, sorgfältig zu einem Drittel von der Zeichnung eines Stempels überdeckt, überlegte mir einen hübschen Namen und eine Berufsbezeichnung, meistens Journalist oder Detektiv – ohne „-in“, die brauchten einen Ausweis, um überall hineinzukommen, soviel wusste ich aus den Abendserien im Fernsehen, die wir manchmal am Wochenende schauen durften, oft auch Schauspielerin – mit „-in“. Ob eine Zeile für die Staatsangehörigkeit und das Herkunftsland vorgesehen war, erinnere ich mich nicht, ich glaube, eher nicht. Jedenfalls hatte ich damals mehrere Identitäten parat, je nachdem, was für ein Spiel damit getrieben werden sollte.
Bei einer Literaturveranstaltung in Wien saßen letztens vier Autor*innen auf der Bühne, die aus den südlichen Nachbarländern Österreichs stammten. In der Diskussion ging es darum, wie oft sie die Frage „Wo kommst du her?“ gestellt bekämen aufgrund ihrer Identifizierung als von wo anders Kommende – entlarvt durch ihre mehr oder weniger stark gefärbten Akzente. Eine der Schriftstellerinnen meinte, dass sie schon nach einem kurzen „Guten Tag!“ die leidige Frage gestellt bekäme, weil ihr Akzent unüberhörbar wäre.
Der und die Schwarzafrikaner/in in Europa, sagen wir in Wien, muss dafür nicht mal den Mund aufmachen. Die Hautfarbe genügt, um als Fremde zugeordnet zu werden. Tagtäglich surfen sie deswegen von Stolperstein zu Stolperstein, werden angerempelt, abgestempelt, hintangereiht und übersehen.
Jad Turjman, der leider viel zu früh bei einer Bergtour verunglückte junge Autor aus Syrien, schickte mir einmal einen Text, in dem es um diese Frage in Zusammenhang mit Dates ging – ein Freund hatte ihm den Tipp gegeben, seine wahre Herkunft zu verheimlichen und sich als Spanier oder Italiener auszugeben – dann würde es definitiv und von Anfang an besser laufen mit Flirts. Damit experimentierte ich bereits als Zehnjährige im Freibad unter der Burg Güssing – es hat, im Spiel, funktioniert.
„Bist du a von wo?!“ sagt man im Burgenland, wenn jemand etwas Dummes, Unverständliches von sich gegeben hat, übersetzt: Wo kommst du denn her, dass du solchen Blödsinn verzapfst, dass du dies oder jenes nicht weißt/kennst? Dann antworte ich mit gespreizten Fingern: „Dobar dan, ma chèrie, je suis de Paris! Willst du einen meiner Pässe sehn?“
Erschienen in der Printausgabe NG1/2023
Karin Ivancsics, geboren 1962 in St. Michael, lebt als Schriftstellerin in Wien, im Burgenland und auf Reisen. Buchveröffentlichungen zuletzt: „Aufzeichnungen einer Blumendiebin“, Klever Verlag, 2021, „Zugvögel sind wir“, edition lex liszt 12, 2022. Mehrere Auszeichnungen, zuletzt Kulturpreis für Literatur des Landes Burgenland 2022.